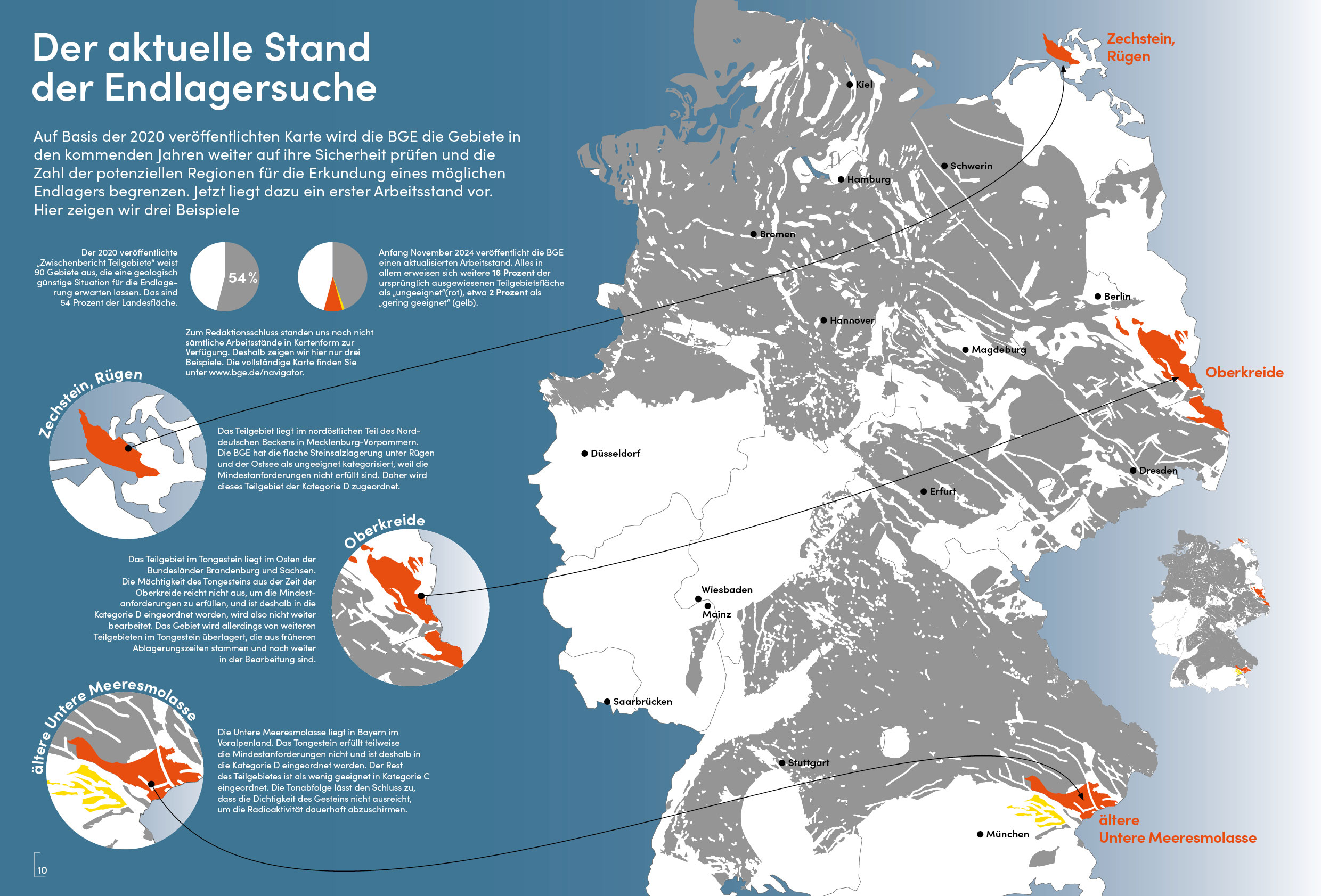Gesucht: Standort des Endlagers für hochradioaktive Abfälle
Endlagersuche
von Horand Knaup Reportage
Die Suche nach dem Endlager für hochradioaktive Abfälle erweist sich als einmalig aufwendig und langwierig. Sie wird Jahrzehnte länger dauern als gedacht. Ständig fließen neue Erkenntnisse in den Prozess ein, verändern ihn dadurch aber auch. Sind wir bereit für ein solches Verfahren?
Einen kurzen Augenblick lang blitzte das Thema auf. Es war Anfang August 2024, und was man in der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und im Berliner Bundesumweltministerium längst wusste, elektrisierte auch die deutsche Öffentlichkeit: Die Suche nach einem geeigneten Standort für das geplante Endlager für hochradioaktiven Abfall wird sich bis mindestens 2074 hinziehen. Zur Erinnerung: Das Standortauswahlgesetz, 2017 vom Bundestag verabschiedet, hatte noch 2031 als Ziel angestrebt.
Und nun eine Verzögerung von mindestens 43 Jahren? Wirklich? „2074 war nicht der Wille des Gesetzgebers“, staunt Matthias Miersch, Jurist, Umweltpolitiker, kommissarischer SPD-Generalsekretär und seinerzeit maßgeblich dabei, die Standortkriterien zu definieren. Ein zeitlicher Zuschlag, von dem zudem keiner weiß, ob er nicht noch deutlich höher ausfällt. Und dann wäre damit ja auch nur eine Standortentscheidung gefallen. Damit sind noch keine unterirdischen Kavernen angelegt und noch keine übertägigen Anlagen, keine Endlagerbehälter entwickelt, und schon gar nicht sind die nuklearen Überreste tief im Erdboden eingelagert. Aber weil die Sache abstrakt ist und die Herausforderung zudem weit in eine unabsehbare Zukunft hineinreicht, war das Thema kurz danach wieder aus den Schlagzeilen verschwunden.
Worum es geht: An den ehemaligen Betriebsstätten deutscher Kernkraftwerke und in den zentralen Zwischenlagern in Ahaus, Gorleben und Lubmin lagern aus 63 Jahren deutscher Kernenergiegeschichte an die 10 500 Tonnen hochradioaktiven Abfalls, verpackt in rund 1900 Castoren, also Lagerbehältern, ein Volumen von rund 27 000 Kubikmetern.

Sicherheit für eine Million Jahre
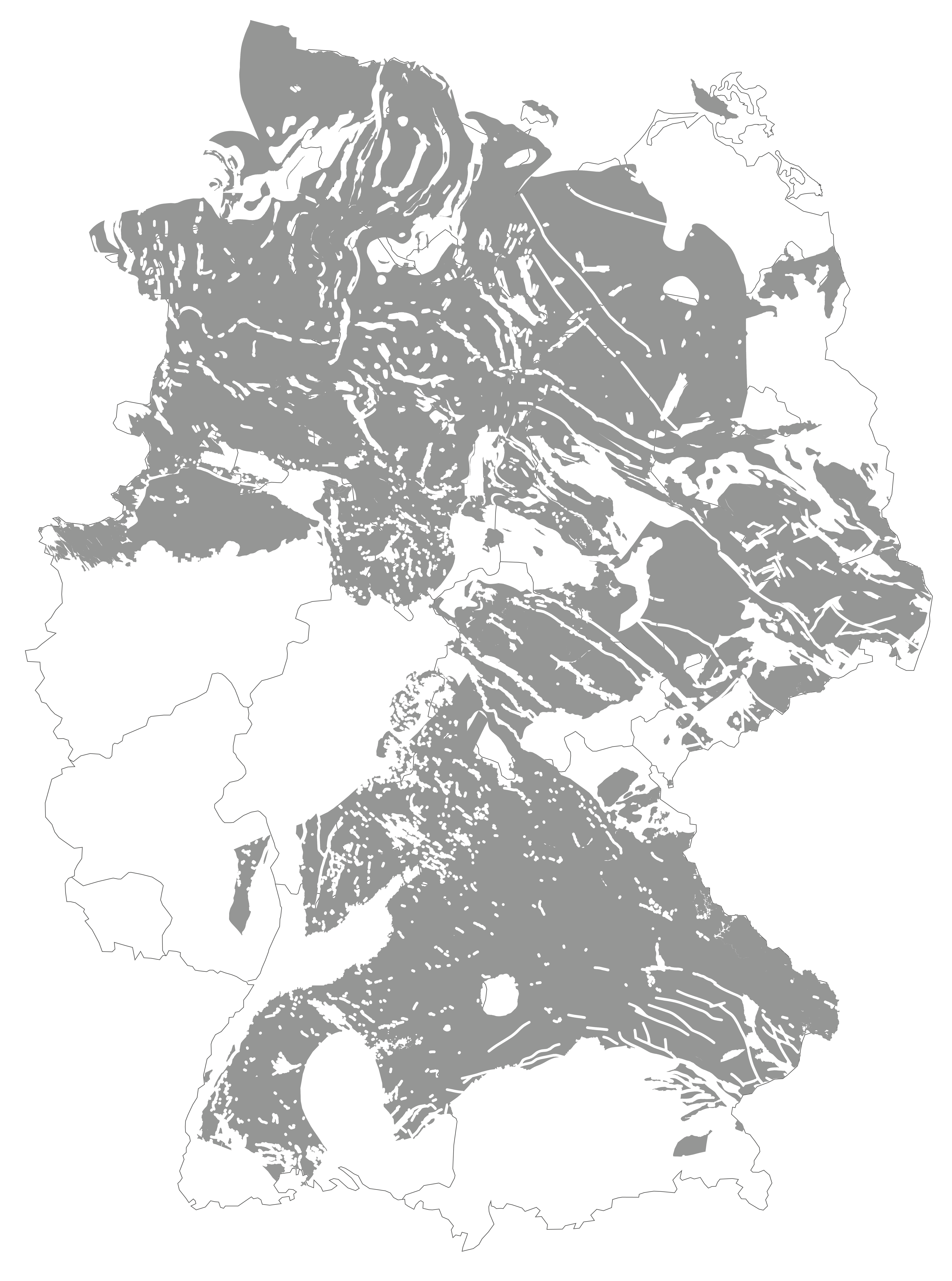
Zwischen 300 und 1500 Meter tief soll der Müll vergraben werden, eine Million Jahre soll er dort sicher ruhen. Die vom Bundestag eingesetzte Kommission verständigte sich darauf, in den ersten 500 Jahren alle Behältnisse wieder nach oben bringen zu können. Für den Fall, dass der technische Fortschritt doch noch Alternativen ermöglicht. Auch die Dokumentation des Endlagers muss auf mindestens 500 Jahre angelegt sein. Im Klartext: Unsere Nachfahren sollen Jahrhunderte später noch in der Lage sein, Material, Mengen, Strahlungskonzentrationen und Gefahrenpotenzial zu erkennen.
Neben der Standortsuche und der Analyse technischer Optionen, den nuklearen Müll zu transportieren, neu zu verpacken und final unter die Erde zu bringen, ist die langfristige Dokumentation eine der vordringlichsten Aufgaben. Bis 2027 will die BGE jedenfalls die Zahl der Standorte eingrenzen und etwa fünf bis zehn Regionen vorschlagen, die überhaupt infrage kommen.
Als der Bundestag 2017 die Standortsuche beschloss, ahnten die Abgeordneten schon, von welcher Dimension das Projekt sein würde, auf das sie sich da verständigt hatten. Noch einmal Matthias Miersch: „Es war immer klar, dass bei einer solchen Dauer nicht alles in Stein gemeißelt sein konnte, was wir beschließen.“ Auseinandersetzungen wird es also weiter geben. Und deshalb sagt Miersch auch: „Ein solches Verfahren hängt immer vom positiven Mitmachen aller Beteiligten ab.“
Die Herausforderungen sind von einer Dimension, die manche mit dem Bau des Kölner Doms vergleichen. Der zog sich auch über sechs Jahrhunderte hin. So lange darf es beim Endlager nicht dauern, aber nicht nur deshalb hinkt der Vergleich. Ein paar Hinweise könnten einen vorsichtigen Eindruck vom etwas anderen Umfang der Herausforderung geben: Allein schon die Frage, ob der radioaktive Abfall rückholbar sein soll oder nicht, hatte die Bundestagsabgeordneten intensiv beschäftigt. Kann man sicher ausschließen, dass es nicht in 200 Jahren bessere Verwertungs- oder Entsorgungslösungen gibt? Soll man die Brennstäbe und die Glaskokillen für immer und final wegschließen oder sie doch zurückholen können?
Projekte quasi für die Ewigkeit
„Cathedral Thinking“ haben anglophone Gesellschaften ehrgeizige Projekte genannt, deren Verwirklichung Auswirkungen auf viele weitere Generationen hat. Es beschreibt eine Mentalität, die es den Menschen ermöglicht, große und besonders spektakuläre Projekte wie die ägyptischen Pyramiden oder auch große Kirchenbauten zu verwirklichen – Projekte quasi für die Ewigkeit. Auch das Sieben-Generationen-Prinzip der Irokesen ist so angelegt: Es besagt, dass der Mensch bei jeder Handlung bedenken sollte, wie sich diese bis in die siebte Generation in der Zukunft auswirkt.
Es ist zugleich eine Denkweise, die den modernen Gesellschaften des Nordens mit Beginn der Industriellen Revolution – und damit dem Kapitalismus – sehr fremd geworden ist. Nachfolgende Generationen mitdenken? Die mögliche Zukunft in die Überlegungen einbeziehen? Die Konsequenzen eines Handelns ausmalen, das erst in 100 oder 200 Jahren oder noch später in seiner ganzen Dramatik erkennbar wird? Das Bemessen der fernen Zukunft, und sei es nur ungefähr, ist für Gesellschaften, die gelernt haben, sich am Vorteil des Augenblicks zu orientieren, zu einer abstrakt-unwirklichen Größe geworden.
Klimawandel, ökologische Zerstörung, Artensterben oder Ressourcenverknappung sind nur die sichtbarsten Anzeichen einer gesellschaftlichen Verfassung, die die Zukunft weder mental noch materiell einpreist. Allein den Begriff Nachhaltigkeit in die Betrachtung von Wirtschaftskreisläufen einzubeziehen, bedurfte eines enormen Kraftaufwandes. Es ist offensichtlich, dass die politische und die kulturelle Verfasstheit insbesondere der nördlichen Hemisphäre die Bedürfnisse zukünftiger Generationen weitgehend ausblendet und in keiner Weise darauf ausgerichtet ist, der Zukunft „Geschenke“ zu hinterlassen. „Vielmehr scheint sie ein effizienter Mechanismus zu sein, um unseren Nachkommen eine vergiftete, degradierte und ärmere Welt zu hinterlassen“, schreibt der Nachhaltigkeitsforscher Nick King.

Ein lernendes Verfahren

Nicht als „Cathedral Thinking“, sondern etwas neutraler und nüchterner als „Lernendes Verfahren“ hat der Abschlussbericht der Bundestagskommission die Suche nach einem Endlager und das damit verbundene politische und technische Prozedere beschrieben. Als ein Verfahren, das „ausreichend Zeit zur Aufbereitung und Verarbeitung der jeweils gewonnenen Ergebnisse“ benötige. Dabei umreißt auch das Lernende Verfahren nur unzureichend, von welcher Dimension die Herausforderung tatsächlich ist. Eine Aufgabe, die alles bisher Bekannte übersteigt. Denn für eine Lagerstätte, angelegt für die Dauer von einer Million Jahren, gibt es keine vergleichbaren Erfahrungen, weltweit nicht, nicht einmal annähernd. Sich überhaupt mit der Unendlichkeit zu beschäftigen, jedenfalls nach menschlichem Ermessen, hatte bisher eher religiösen oder spirituellen Charakter. In diesem Fall ist die Herausforderung jedoch sehr materiell und sehr konkret: Jetzt müssen große Mengen hochstrahlenden Abfalls jahrtausendsicher eingelagert werden.
Ohnehin hatten sich die Verantwortlichen bei der BGE das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, als sie sich der Aufgabe näherten. Es fing schon mit den geologischen Daten an. Als die Expert*innen begannen, Daten, Karten, Skizzen und sonstige Unterlagen zusammenzutragen, drangen sie in einen Dschungel ein. Nichts war geregelt, keine Verfahren, keine Abläufe, keine Verantwortlichkeiten. Nur ein marginales Detail: Die Fachleute bemerkten schnell, dass Tiefenbohrungen in Deutschland auch im Jahr 2017 noch dem Lagerstättengesetz aus dem Jahr 1934 unterlagen, also quasi ungeregelt waren.
Problemfall: Betriebsgeheimnis
Bei der BGE begannen sie alle verfügbaren Materialien zusammenzutragen, schrieben 64 Behörden an. Was einem Hindernislauf glich: Ein Bundesamt und 16 Landesämter, Ministerien, Wasserbehörden, unterschiedliche Dokumentationssysteme. Kaum etwas war digitalisiert, nichts vereinheitlicht. „Es kamen Papierunterlagen, PDF-Dateien, 3D-Modelle, alles durcheinander und zumeist ohne Basisdaten“, erinnert sich eine Beteiligte. Geologische Verwerfungen, kartografisch festgehalten, endeten abrupt an der Landesgrenze, Salzstöcke lagen ganz anders als vermutet. Und nicht immer war die Bereitschaft da, das eigene Wissen auch zu teilen. Ein Unternehmen schickte bewusst irreführende Daten, um keine Betriebsgeheimnisse offenzulegen.
Bis 2020 waren die Erhebung geologischer Daten, ihre Sicherung und Verfügbarkeit eine juristische Ödnis. Erst im Juni 2020 löste ein Geologiedatengesetz das alte Regelwerk ab. Zum ersten Mal überhaupt wurde nun der ungehinderte Zugang oder auch eine dauerhafte Lese- und Verfügbarkeit für alle bestehenden und künftigen geologischen Aufgaben des Bundes und der Länder verankert.
Inzwischen arbeiten 120 Expert*innen bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung an der Suche nach einem sicheren Tiefenlager. Physiker*innen und Geolog* innen, Kartograf*innen und Strahlenschützer* innen, Materialforschende und Logistiker*innen. Bleibt die entscheidende Frage: Schaffen sie das? Schaffen wir das?

Endlagerbehälter gesucht
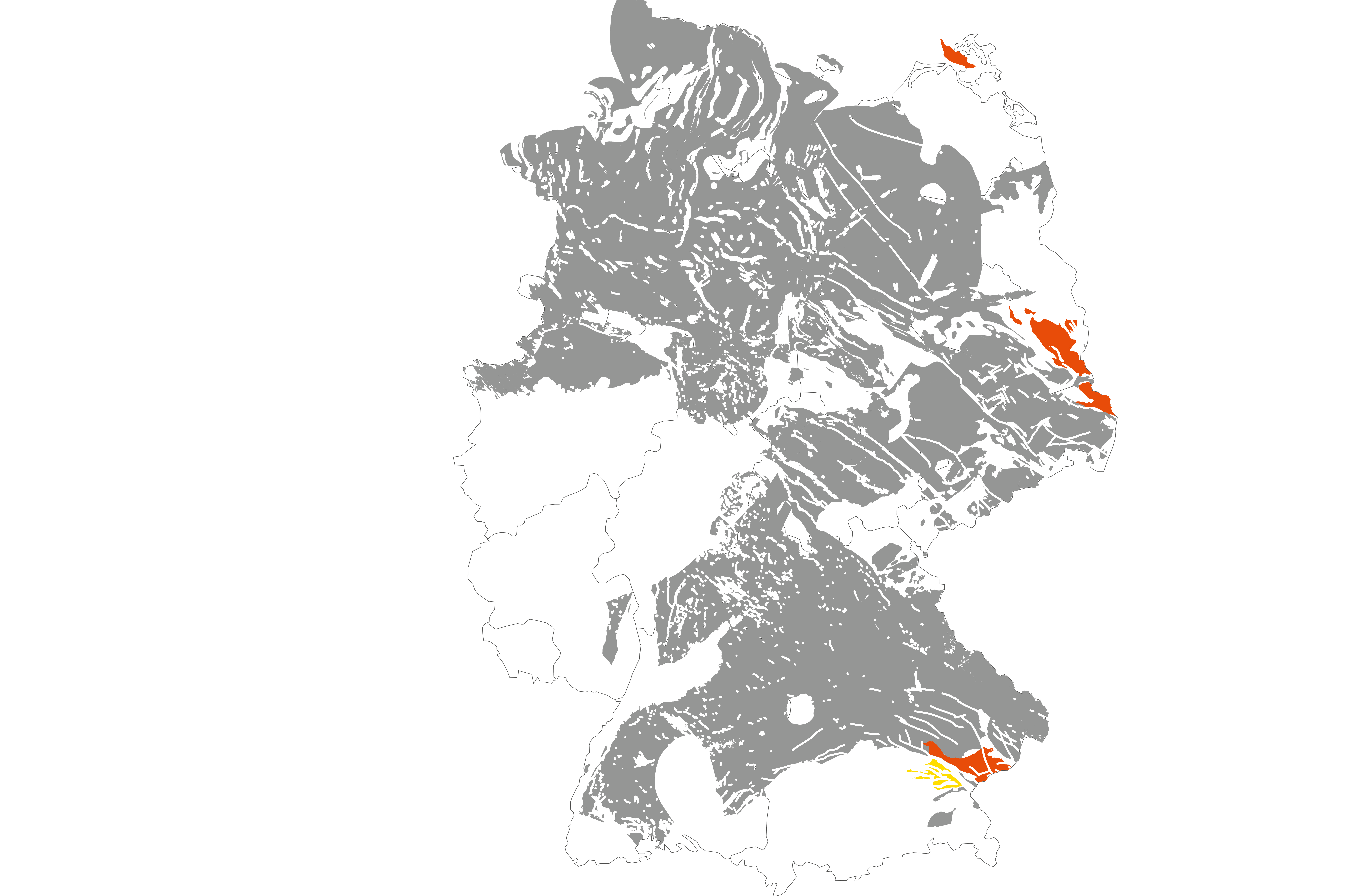
Erst einmal steht die Suche nach dem geeigneten Ort mit allen geologischen Voraussetzungen im Vordergrund. Erdbeben- und vulkanismusgefährdete Regionen wie die Eifel scheiden daher aus. Der Untergrund sollte sich über Hunderttausende von Jahren nicht mehr bewegen. Schon ein Millimeter pro Jahr ist zu viel. Weshalb auch geologische Formationen wie die Alpen oder der Oberrheingraben nicht infrage kommen. Auch die Sicherheit vor einem Wassereintritt im Untergrund ist ein zentraler Punkt.
Und dann sind da, nicht weniger herausfordernd, die vielen ganz praktischen Fragen: Wodurch lassen sich die mehr als hundert Tonnen schweren Castoren ersetzen? Wie schwer werden die späteren Endlagerbehälter? Will man diese möglicherweise auf Rampen in die Tiefe bringen oder über einen Schacht?
Oder auch die Frage, aus welchem Material die Endlagerbehälter sein müssen, in die der hochradioaktive Atommüll verpackt werden soll. Je nach Umgebungsgestein müssen sie unterschiedlichen Anforderungen standhalten. Die Castoren, derzeit gängige Form der Zwischenlagerung, sind aus Gusseisen. Ein robuster Werkstoff – aber ist er auch der richtige für die Endlagerung?
Herausfordernde Logistik
Eine weitere Herausforderung ist die Logistik im weitesten Sinne. Wie kommt der Abfall aus den Zwischenlagern in sein finales Depot? Auf der Straße? Auf der Schiene? Wie ist ein sicherer Transport zu gewährleisten? Einigkeit besteht nur darin, die Zahl der Transporte möglichst gering zu halten. Aber wie viele Castoren kann man auf einmal transportieren und auch am Endlager annehmen? Fragen über Fragen – nur wenige sind bisher beantwortet. Schließlich – und nicht zuletzt – die politische und die gesellschaftliche Entscheidung in der Standortfrage. Sie dürfte sich jenseits aller technisch-administrativen Fragen noch als eine der größten Herausforderungen erweisen. Absehbar ist: Kein Ministerpräsident wird die Entscheidung begrüßen, sollte sein Bundesland in die Vorauswahl geraten. Wenn das Votum näher rückt, wird keiner versuchen, seine Region von der Notwendigkeit oder der Sinnhaftigkeit der Entscheidung zu überzeugen. Einen Vorgeschmack des Debattenniveaus hat die Bayerische Staatsregierung schon mal gegeben, als sie im Frühjahr 2023 „gute fachliche Argumente“ ins Feld führte, warum bayerische Standorte auszuschließen seien, während sie gleichzeitig den Salzstock im fernen niedersächsischen Gorleben für geeignet erachtete.
Von Beginn an waren sie im Bundestag und in der begleitenden Kommission deshalb um eine konsensuale Lösung bemüht. Von Beginn an sei klar gewesen, erinnert sich Matthias Miersch: „Wir brauchen Begleitstrukturen.“ Und doch habe immer Klarheit geherrscht: „Am Ende wird es eine umstrittene Entscheidung sein.“ Und weil das Ergebnis absehbar strittig sein wird und der Weg dorthin auch, sind alle bemüht, schon im Frühstadium Fehler möglichst zu vermeiden. Weil allen sehr bewusst ist: Frühe Fehler schaffen Unruhe, erhöhen die Skepsis in einem ohnehin umstrittenen Verfahren und delegitimieren im schlimmsten Fall das ganze Verfahren. Um die Auseinandersetzung um den Standort einzugrenzen und Konflikte frühzeitig zu entschärfen, empfahl die Expertenkommission des Bundestages ein Nationales Begleitgremium (NBG), 18 Personen stark, von denen jeweils sechs von Bundestag und Bundesrat nominiert, die übrigen sechs zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt werden sollten. Schon der Start verzögerte sich. Als ein turnusgemäßer Wechsel anstand, konnten sich Bundes- und Länderkammer nicht einigen. Die Folge: Seit über zwei Jahren ist die Bundesratsliste unvollständig.
„Am Ende wird es eine umstrittene Entscheidung sein“ Matthias Miersch (SPD)
Beteiligung der Öffentlichkeit
Ein weiteres Spannungsfeld: Die einen in der Endlagerkommission wollten ein Maximum an Beteiligung, die anderen „ein überragendes öffentliches Interesse“ definieren, um die Einspruchs- und Klagemöglichkeiten nicht ins Uferlose abdriften zu lassen. Und weil auch juristische Fragen von erheblichem Belang sind, wurde gleich mit definiert, welche Argumente bis wann vorzubringen sind und irgendwann kein Gehör mehr erfahren können. Noch einmal Matthias Miersch: „Es war allen klar: Wenn wir das nicht definieren, werden wir es nicht schaffen.“
Natürlich könnten wir es schaffen, entgegnet der Zukunftsforscher Thomas Druyen, der in Wien Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement lehrt. Auch wenn es „bisher nicht unsere zentrale Kompetenz war, mit Neuland souverän umzugehen“. Jahrtausendelang sei Bildung das Tor zur Zukunft gewesen, letztlich die Fähigkeit, „sich eine lebensgelingende Kompetenz anzueignen“. Doch erlerntes Wissen zählt in Zeiten von Internet und Künstlicher Intelligenz nicht mehr viel. „Wir haben mehr Wissen als jemals zuvor und verstehen weniger als jemals zuvor“, konstatiert Druyen. Also doch ungünstige Voraussetzungen für eine Menschheitsaufgabe?
Nicht unbedingt, sagt Druyen. Früher hätten sich Wissen und Kompetenz aus der Vergangenheit ergeben. Heute kämen die Impulse aus der Zukunft. Die Geolog*innen und die Ingenieur*innen, die Strahlenexpert*innen und die Materialforschenden, all die, die sich mit den strahlenden Überresten und ihrer Endlagerung befassen, müssten „eine neue, agile Fähigkeit entwickeln, die mit Unvorhersehbarkeit, mit Überraschungen und ständiger Verwandlung – also mit dem unbekannten Kommenden – vorausschauend umgehen kann“. Die Zukunft war nie vorhersehbar, ist sie auch heute nicht. Aber es bedürfe einer besseren Kompetenz, „mit Veränderungen, Schnelligkeit, neuen Lösungen, mit Überraschungen und radikal veränderten Geschwindigkeiten umzugehen“, sagt Druyen. Eine Kompetenz, die durchaus erlernbar sei. Die neue Anpassungsfähigkeit liege „im Ausprobieren, im Experimentieren und Fehlermachen sowie im wiederholten Ziehen weiterführender Schlüsse“.
Eine neue Fehlerkultur
Nicht zuletzt geht es dabei auch um eine neue Fehlerkultur. Es geht darum, Fehler zu akzeptieren, sie einzupreisen, sich nicht zuerst mit Verantwortung, Zuständigkeiten und Schuldzuweisungen zu beschäftigen, sondern schnörkellose Schlüsse aus Irrtümern zu ziehen, die es zwangsläufig geben wird. Es geht darum, Erkenntnisse zu gewinnen und sie umgehend praktisch umzusetzen. Aber genau das wird eine besondere Herausforderung bleiben. Druyen: „Für eine Kultur, die ‚Fehler‘ jahrzehntelang als Feind betrachtet hat, ist diese Umstellung nicht leicht.“
Die globale Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 gab einen ersten Eindruck, wie man sich der Problembewältigung der Neuzeit nähert. Die Ausgangslage: ein vielfach tödliches, zugleich rätselhaftes Virus, kein bekanntes Medikament dagegen und im Sport-, Bildungs- und Kulturbereich – um nur wenige Sektoren zu nennen – maximale Unsicherheit, wie weit zum Beispiel Kontaktbeschränkungen reichen sollten.
Weltweit operierten die Gesellschaften nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. In der Forschung, in der Therapie, in den Fragen von Ansteckungsgefahr und Kontaktsperren. Seither sind digitale Konferenzen, die es vorher nur in Ausnahmefällen gegeben hatte, in den Alltag vieler Unternehmen und Institutionen eingezogen, mithin quasi Standard. Bezogen auf die Endlagersuche heißt das: „Wir arbeiten in einer permanenten Vorläufigkeit“, wie es eine BGE-Expertin formuliert. Daran wird sich wohl auf Jahrzehnte hinaus nichts ändern.
„Für eine Kultur, die ‚Fehler‘ jahrzehntelang als Feind betrachtet hat, ist diese Umstellung nicht leicht“ Thomas Druyen, Zukunftsforscher
"Die ultimative Kathedrale"
Zurück zur konkreten Herausforderung. Denn nun drängt erst einmal die Zeit für ein anderes Problem: Für die Zwischenlager in Ahaus, Gorleben und Lubmin laufen die Genehmigungen bereits 2034 und 2036 aus, für die übrigen Standort- Zwischenlager rund zehn Jahre später. Die ersten Verlängerungen werden also bereits in rund zehn Jahren benötigt, weil es bis dahin ganz sicher noch keine Lösung geben wird.
So groß also die Herausforderung ist, sie könnte auch eine Chance sein. So sieht es jedenfalls der Autor Nick King. Das moderne Kathedralen-Denken, so King, könne „eine Inspiration für konzertierte und entschlossene Bemühungen sein, unsere kurzfristigen Wünsche zurückzustellen und stattdessen darüber nachzudenken, was wir den Generationen der Zukunft weitergeben sollten“.
Auseinandersetzungen und Konflikte seien unvermeidlich, und es werde auch nicht ohne die harte Arbeit, die Opferbereitschaft und die Nüchternheit der antiken und mittelalterlichen Kathedralenbauer gehen, meint King. Es könne im besten Fall aber auch dazu führen, „dass wir die ultimative Kathedrale weitergeben: einen bewohnbaren Planeten und die Chance auf eine langfristige Zukunft für unsere Zivilisation“.